Eine Ausstiegsgeschichte
Der Journalist Olivier David hat mit Keine Aufstiegsgeschichte ein Buch über seine Biographie geschrieben, über Armut, Psyche und Gesellschaft. Ein ungemein wichtiges Buch, findet Martin Spieß.
Allein der Titel von Olivier Davids Buch ist deprimierend und entmutigend zugleich. Keine Aufstiegsgeschichte heißt es. Denn wie automatisch wünscht man sich (und ihm!) nach der Lektüre des Klappentextes eine solche Aufstiegsgeschichte: Seht her, ich war ganz unten, aber ich habe es rausgeschafft.
Dass derartige Geschichten das System nicht bestätigen, sondern seltene Ausnahmen unbarmherziger Regeln sind, das ist eigentlich vor der Lektüre des Buches klar, um die man sich eigentlich gerne herumdrücken möchte: Wenn das Lesen einen schon so anfasst, fragt man sich, wie muss es gewesen sein, das zu leben und (immer noch) mit sich herumzutragen?
Olivier David trägt viel, nicht nur seine Biografie an sich, sondern auch ihre Folgen: Aufgewachsen in Armut, sein Vater ist Drogendealer und schlägt Frau und Kinder, seine Mutter ist immer wieder (schwer) depressiv, irgendwann werden bei ihm selbst eine Depression und ADHS diagnostiziert, er kämpft mit Wutanfällen.
Vom Supermarkt in die Lagerhalle
Seine Schulkamerad*innen gehen wie selbstverständlich studieren – wenn Eltern einem vorleben, wie „normal“ eine akademische Laufbahn ist, und wie die Codes sind, die man anzuwenden hat –, ist es wahrscheinlicher, dass man selbst studieren geht. David jobbt in Supermärkten, in Lagerhallen, er kifft und trinkt viel, er zieht sich zurück: Wer wenig Aussicht auf Erfolg hat und sich doppelt und dreifach anstrengen muss, damit es auch nur zum Leben reicht, der verzweifelt an der Last, am Druck. Dessen Kraft wird aufgezehrt, dessen Wut bricht sich Bahn. Der Untertitel des Buches, das sei hier ergänzt, lautet: Warum Armut psychisch krank macht.
Ein System, das krank macht
Dass die Heilsversprechen des (neoliberalen) Kapitalismus’ und des US-amerikanischen pursuit of happiness Mären sind, ist schon lange klar, ändern aber tut sich wenig, im Gegenteil. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, immer weniger Menschen besitzen immer mehr und andersherum. Menschen wie Olivier David gibt es zuhauf, die an einem System leiden, sich abarbeiten, krank werden oder daran zerbrechen. Alkohol, Drogensucht, Kriminalität – zum Teil sind das nur Symptome der Lebensumstände dieser Menschen, Reaktionen auf Ängste, Druck, Schwierigkeiten und Ausweglosigkeiten. Wie wenig auf diese Umstände eingegangen wird, wie surreal es eigentlich ist, dass studierte Menschen über die Taten von Menschen urteilen, die ganz unten leben, auch davon erzählt Olivier David, und man erinnert sich unweigerlich an Dostojewksi, der mal geschrieben hat: „Den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft kann man am Zustand ihrer Gefangenen ablesen.“
„Meine Wut wird nie ganz verschwinden“
Olivier David ist nicht kriminell geworden, aber er kämpft mit den Wunden und Narben, die seine Biographie hinterlassen hat. Schonungslos ehrlich erzählt er davon, wie seine Mutter, seine Schwester und er sich anschrien, wie er seiner Mutter mit Schlägen drohte, wie er ganz am Ende offenlegt, dass seine Wut „nie ganz verschwinden“ würde, „da mache ich mir nichts vor.“
Er erzählt von seiner Therapie, davon, wie er sich auf Spurensuche begibt, seinen nach China ausgewanderten Vater besucht, um nachzufühlen, was diesen Mann antreibt, was, wenn überhaupt dieser an ihn weitergegeben hat. Er geht allein in den Pyrenäen wandern, um zu sich zu finden, findet aber auch dort nur Angst, Beklemmung und Wut, er fährt zur Beerdigung seiner Großmutter und erzählt davon, wie sein Vater und er sich dort das erste Mal halbwegs annähern. Und er berichtet, wie er es trotz aller Widrigkeiten schafft, eine Ausbildung an einer Schauspielschule und ein journalistisches Volontariat zu absolvieren. Aber auch hier gilt: Das ist keine Aufstiegsgeschichte – „mit meinen schmalen Einkünften als freier Journalist gehöre ich zum Prekariat –, David nennt es eine „Emanzipation, eine Ausstiegsgeschichte.“
Olivier Davids Keine Aufstiegsgeschichte ist ein ungemein wichtiges Buch, weil es zeigt, wie viel Arbeit noch vor uns als Gesellschaft liegt, dem Kapitalismus zumindest ein humaneres, gerechteres Antlitz zu verpassen, und wie wichtig es ist, eben jene Menschen zu entlasten, die unter dem gegenwärtigen System so sehr leiden.
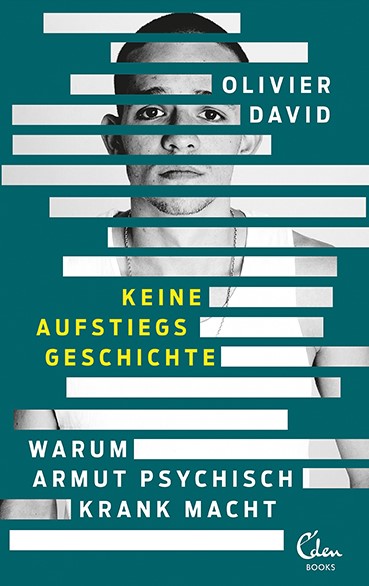
Eden Books, 2022
240 Seiten Seiten
16,95 Euro

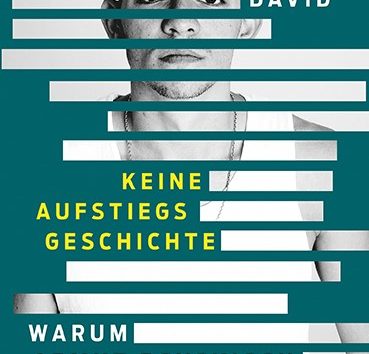
2 thoughts on "Eine Ausstiegsgeschichte"
Kommentieren ist nicht möglich.